In meiner Nähe gibt es einen künstlichen Teich. Er liegt zwischen Neubauten mitten im Grünen und bietet viele saubere Sitzgelegenheiten. Der Ort ist ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Ich bin auch gerne dort; allein, beobachtend und innerlich zerrissen. Wenn ich nah ans Ufer trete, sehe ich Bewegungen unter der Oberfläche, nur mein Spiegelbild rührt sich nicht. Manchmal, wenn mein Blick länger auf den Jugendlichen verweilt, fühle ich die Anwesenheit von etwas Vertrautem. Es ist so nah, dass ich es riechen kann. Eine Erinnerung, deren Intensität die Sinne verwirrt. Ich habe den Geschmack dieser unwiederbringlichen Zeit im Mund, als Freundschaft etwas Selbstverständliches war, und Kommunikation ohne große Anstrengung passierte.
Es war 1996 und ich war kein Kind mehr, was so viel bedeutet, dass mein MickyMaus Abo nicht verlängert wurde. Als polnische Migrantin in Deutschland sehnte ich mich nach einem sicheren Ort zwischen den beiden Welten, in denen ich mich zwangsläufig bewegte. Die Tugenden und Ideale der einen waren die Laster und das Unerwünschte der anderen. Wofür ich in der einen Welt gelobt wurde, dafür wurde ich in der anderen bestraft. Es musste einen Zwischenraum geben, wo es erlaubt war, die Widersprüche der Sozialisation zu überwinden. Diesen Ort fand ich hinter Turnhallen, Schwimmbädern und Supermärkten, auf Hintertreppen und im wilden Gestrüpp. Nach der Schule traf ich dort meine beste Freundin. Tag für Tag, die Kippen immer in der verwaschenen Innentasche der Jeansjacke von Levis. Ein entwurzelter Baumstamm war für uns die Welt. Ein Baumstamm hinter dem Schwimmbad, am Fluss, im Gebüsch. Wir führten ein kleinkariertes Buch über unsere Gedanken, das wir einander täglich zum Lesen überreichten. Die Seiten waren so eng beschrieben, dass zwei bis drei Buchstaben in ein Kästchen passten. Wir füllten den ganzen Raum mit uns aus. Wir schrieben, wie wir redeten: ausufernd und überbordend, ohne Angst vor Begrenzungen. Mit jeder Zigarette sog ich das selbstbestimmte Leben ein, auf das ich zu Hause, wo Unverheirateten keine Privatsphäre zustand, nicht das Recht hatte. Heim gingen wir erst, wenn die Schachtel leergepafft war. Vor dem Schlafengehen bereitete ich mich auf den nächsten Tag vor, indem ich das Buch unserer Freundschaft erneut füllte. Dabei war meine Freundin, aus rechtlichen Gründen nenne ich sie Marzena, ganz anders als ich. Sie konnte sich Naturlocken um den Finger wickeln, ich hatte nur dünne Fäden am Kopf. Alles an ihrem knochigen Körper sah „heiß“ aus, während ich in denselben Klamotten, im Spiegel der geteilten Umkleidekabine, eine einzige Mangelerscheinung war. Marzena hatte engstehende kleine Augen, eine spitze Nase, ein etwas zu stark hervortretendes Kinn. Die Zähne sehr ebenmäßig und gerade, Zeichen eines willensstarken, durchsetzungsfähigen Bisses. Und jede Woche eine andere Männerhand unter dem T-Shirt, in der Hose, immer andere Zungen im Mund. Im Park, im Kino, in den Schultoiletten an leeren Nachmittagen, in unserem Buch nahm sie mich mit. 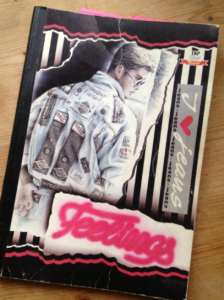
Meine Augen waren groß, aber dadurch nicht ausdrucksstark, dafür bekam die Nase einen immer ausdrucksstärkeren Höcker. Und meine Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht hat später ein Klassenkamerad in einem Gedicht für mich gut zusammengefasst: „She loves guys with long hair / but for them she‘s only air.“ Die Freundschaft zu Marzena zog mich im selben Maß runter, wie sie mich aufzubauen vermochte. Aber unterm Strich wollte ich tot sein.
Ich wusste nie, wie es ist, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Meine Eltern sind von Natur aus keine Netzwerker, die große Parties veranstalten oder besuchen würden. Selbst wenn sie es wären: In Deutschland stand der Zähler sozialen Kapitals erst einmal auf Null. Und daraus folgte die Unsichtbarkeit, ein gesellschaftlicher Nicht-Status. Das dorfgemeinschaftliche Man-kennt-sich verlieh den Einheimischen und Alteingesessenen eine Selbstverständlichkeit, die wir als eingewanderte Familie nie haben würden und die ich, obwohl mit größerem Integrationspotenzial gesegnet als meine Eltern, auch nicht ohne Weiteres würde erreichen können. Wie denn auch? Dabeisein war nicht alles. Man brauchte eine Daseinsberechtigung. Und die hatte man aufgrund von drei Generationen Schützenverein und einem Reihenhaus in „guter Gegend“. Dementsprechend fehl am Platz fühlte ich mich auf Gartenparties und Übernachtungsbesuchen, auch wenn ich durchaus willkommen war. Hätte man mir sonst ein Yakult auf den Frühstücksteller gestellt?
Die neunte und zehnte Klasse habe ich irgendwie überlebt. Dann kam die Oberstufe. Von einem Tag auf den anderen wurden Gewissheiten umgeblasen. Als die Schulklassen aufgelöst wurden, um zu einer Stufe zu verschmelzen, erwies sich alles, was ich über die Unmöglichkeit von Zugehörigkeit gedacht hatte, als überdramatischer Teenager-Blödsinn. Vorher war jede andere Klasse ein anonymes, monströses Wesen, jeweils zusammengesetzt aus einer einzigen Menschensorte. Klasse A brachte nur Muttersöhnchen und brave Mädchen hervor, die nie aus ihren Kindercordhosen herauswachsen würden. In Klasse B schienen alle über 1,80 zu sein. Klasse C war die eigene und damit die einzige, die aus Individuen bestand, und in Klasse D waren die ganzen Asis mit Baseball-Jacken drin, frühreif und Bandenmitglieder. Nun, da alle zusammen in einen Topf geworfen worden waren und jedes Fach in anderer Konstellation stattfand, verpuffte alles, was man übereinander zu wissen meinte, im anbandelnden Schulhof-Geschnatter. Von den Real- und Gesamtschulen kamen Schönheiten mit grünen Augen, Kopftuchmädchen, frisch geschlüpfte Schwule und literaturbegeisterte Jungs mit dreistelligem IQ. Es kamen neue Lehrer, die nicht wussten, dass ich „aus Polen komme“ und mir eine Wertschätzung entgegen brachten, die ich nicht gewohnt war. Keine amüsierten, in ihrer Ignoranz bemerkenswert wissenden Klassenlehrerblicke mehr, die mich zum Dummkopf abrichteten und einen Mangel an Selbstbewusstsein für das Fehlen von Persönlichkeit hielten. Kein Erröten mehr, wenn ich etwas gefragt wurde. Ich trug das Herz am rechten Fleck, es rutschte mir weder in die Hose noch kam es mir pochend hoch. In den Pausen stand man cliquen- und klassenlos in der Raucherecke, teilte seine Zigaretten mit den Älteren wie mit den Neuen, und fragte sich unentwegt, wie einem diese wunderbaren Menschen, mit denen man jetzt leicht und locker ins Gespräch kam, nur so lange hatten entgehen können.
Ich weiß noch, wie der Gesang der Bäume sich in diesen wenigen Monaten veränderte. Am Anfang waren es graue Säulen, die so viel größer waren als ich. Ihre Äste unerreichbar, die Kronen rauschten bedrohlich, während der Wind mich in die Schule trieb. Als wir alle auf einmal begannen, uns dem Neuen und Anderen zu öffnen, hat das eine Stimmung geschaffen, die mich in einen anderen Daseinszustand versetzte. Die Bäume raschelten nicht mehr, als würden sie mich scheuchen, husch husch,was hast du hier zu suchen, lauf! Das Wogen der Äste hatte so viel Zärtlichkeit wie eine Hand, die einem über das Gesicht streicht. Die Bäume spendeten Schatten, die Blätter filterten das Licht, in dem ich gewärmt war, von dem ich umhüllt war wie von einer schützenden Decke. Nach einer durchgemachten Party, kurz vor den Sommerferien, schlief ich unter so einem Blätterdach, auf einer Brücke, die von der einen zur anderen Schule führte. Eigentlich war es nur ein hölzerner Steg über einen plätschernden Bach. Ich lag zwischen meinen neuen Freunden und ihren Rucksäcken. Wir verschliefen die ersten Stunden Bio-Chemie mit einer paradiesischen Gleichgültigkeit. Andere mögen uns mit verwunderten Blicken gestreift haben, aber wir rückten nur näher zusammen und berührten einander. An den Händen, an den Haaren. Alles war ein warmer Fluss, der mich trug, ein Leben auf Beruhigungstablette. Kein Kampf mehr, keine Flucht, nur ein selbstverständliches Fließen mit dem Strom guter Gefühle.
Denke ich heute daran zurück, kommen mir Tränen, die herrühren von der Erfahrung des Guten, das man zu lange entbehrte. Das erste Jahr in der Oberstufe war ein himmlischer Zustand, eine surreale Utopie. Ich hatte keine Gelegenheit, diese Empfindung zu entzaubern. Bald musste ich in eine andere Stadt ziehen.Meine Schlafträume führen mich immer wieder in diese Zeit und an diesen Ort und zu diesen Menschen zurück. Durch die saftgrünen Wipfel der Bäume falle ich aus meinem einsamen Leben in ihre offenen Hände. Ich spüre den festen Griff des Mädchens, das mich auffing, als ich betrunken war. Sehe das Funkeln in ihren Augen, weil ich „Wonderwall“ spielen konnte auf meiner Gitarre. Ich drücke mich an die Jungs in ihren Slipknot-Hoodies, schnuppere ihr Rasierwasser, rieche die Veränderung, das plötzliche Vertrauen zwischen uns.
Wenn ich aus diesen Träumen erwache, bin ich Kate Winslet neben der sinkenden Titanic, der die Hand des Geliebten entgleitet, bevor ihn die schwarze Tiefe verschlingt. Nur, kaum dass ich anfange zu knatschen und von der Frage erdolcht werde, wann ich denn das letzte Mal diese Art der Verbundenheit gespürt habe, kommt mir eine realtiv junge Erinnerung in den Sinn, und das ist mein Leben mit Twitter.
Zumindest am Anfang war dieser Kult der Twitter-Enthusiasten all das, was der Neubeginn in der Oberstufe verhieß: Neue Chancen für alle! Offenheit für alle! Liebe für alle! Wehmütig denke ich an die Twitter-Parties im kleinen Kreis (100-200 Leute) zurück, wo man sich nicht erst groß kennen lernen musste, weil man jeden bereits als „Idee“ kannte – und liebte. Der Vater dieser Parties war Huck Haas, „der erste Mensch auf Twitter“ (Neueß Conversationslexicon). Da war die bezaubernde Muserine mit ihrem Emo-Witz, und Sir Schlenzalot trug wirklich Schlangenhosen! Man berührte, umarmte, küsste und liebkoste seine Vorstellungen von den „Charakteren“, die zugegen waren. Was nicht zur Idee passte, trotz aller Verschiedenheit durch das Menschsein verbunden zu sein, haben wir ausgeblendet. Nicht weil wir dumm waren, sondern weil wir es konnten. Es war eine Form der Großzügigkeit, ein Vorschuss an Vertrauen, der eine größere emotionale Ausdrucksfreiheit ermöglichte. Und das erzeugte eine Wärme im Bauch, dass man meinte, in einer Broschüre der Zeugen Jehovas zu sein.
Warum also sitze ich heute trübselig am Teich und trauere um meine Jugendjahre, wenn ich mich vor nicht allzu langer Zeit ähnlich gut aufgehoben gefühlt habe? Warum bedeutet „Twitter-Party“ nicht mehr Liebe, sondern Angstschweißen und Stress?
Vermutlich wäre es mir in der Oberstufe damals, wenn ich in dieser Stadt hätte bleiben können, ähnlich ergangen wie mit „Menschen bei Twitter“. Ein Budenzauber, egal von welcher Art, kann oft von einem einzigen Kleingeist zunichte gemacht werden. Es gibt Neider, denen die Harmonie nicht passt und Menschen, die ihre Dummheit nicht für sich behalten können. Und auch wenn niemand den Miesepetern in ihrem Hass so recht folgen mag, ertappt man sich früher oder später bei Gedanken wie: „Wenn die da hingeht, geh ich da nicht hin.“ oder: „Ich geh nur hin, damit die nicht hingeht“, etc. und schon ist man wieder 14 und dümpelt in der Brühe emotionalen Elends. Danke, Party-Pooper! Die Erfahrung hat außerdem gezeigt, dass es nahezu unmöglich ist, einem Twitter-User ein Geheimnis anzuvertrauen. Er wird es mit hundertprozentiger Sicherheit ausplaudern, und das ohne jeden bösen Willen. Die Offenheit, die am Anfang jeder Twitter-Begegnung steht, verführt dazu, sich gegenseitig kleine Geheimnisse und pikanten Gossip anzuvertrauen. Man meint, sich sehr gut zu kennen, schließlich trifft man sich öfter in der Timeline, als man seinem Partner in der Küche begegnet, da schaltet man automatisch in einen Dunkelmunkelmodus. Genauso leicht fällt es, die anvertrauten Geheimnisse auszuplaudern, denn so gut kennt man sich dann doch wieder nicht, dass man das nicht bringen könnte, so die Rationalisierung. Und was Internetbekanntschaft X mir über Internetbekanntschaft Y erzählt hat, kann ich doch auch den Anderen verraten, ohne dass es mir moralisch auf dem Magen liegt. „Ist ja nur Internet.“
Was machen aus den Erfahrungen mit Menschen und Twitter? Ist es naiv, an Offenheit und Liebe zu glauben, an Liebe durch Offenheit? Führt alles zu Enttäuschung und Schmerz? Sollte man den raren Augenblick einfach gedankenlos umarmen, weil die Momente, in denen alle nicht anders können, als OFFEN drauf zu sein, so selten sind?
Nach Menschen und Profilen habe ich mir jedenfalls wieder eine neue Glücksquelle erschlossen: die Tiere. Ich könnt sie alle so knuddeln!!!! For now.
Mal sehen…
Permalink //
Immer wenn man denkt, man sein angekommen, geht die Suche von vorne los.
Permalink //
Herzerl, so wie du das schreibst, sehen und fühlen es die meisten. Jeder dann wieder for so long an seinem Teich bis zum Zwangstanztee der Pflegekasse muss es dann aber auch nicht sein.
Verzeiht mit Flausch oder Weinschorle oder verprügelt die es verdient haben. Bleib bei mir und drück mich.
Dein Hashtag
Permalink //
Danke für das (Mit-)Teilen. Vielleicht hat ja jeder so einen flüchtigen Ort in seiner Erinnerung in den er sich zuhause fühlte. Einen Ort des wohligen Angenommenseins. Irgendwo.
Auf einer Twitter-Party war ich noch nie. Warum auch. Bin ich doch jenseits allen Wortwitz, jenseits von Galanterie und nicht vertraut mit der Kunstfertigkeit der Kurzfiktion bei Twitter eher ein flacher Charakter. Allerdings ist es mir mal ähnlich ergangen. Mit Blogger-Treffen. In einem Land vor Social Media und so.
Das Offensein für Neues und Anderes ist ebenso wenig jeder frau/manns Sache wie die Suche nach Harmonie. Schade eigentlich. Mag das auch. Mehr noch als auf Twitter jemals möglich, neigten einige Blogger meines Tribes damals zur übermäßiger Psychologisierung. Das war dann irgendwann ouch.
Aber deine Tweets mag ich, sehr. Den Feed deines Blogs habe ich jetzt abonniert.
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink //
Du schreibst wirklich wundervoll – eine Freude, einen solchen Schreibstil zu lesen.
Inhaltlich bin ich nicht ganz bei dir, was vielleicht daran liegen mag, dass meine Schulzeit nicht die schönste Zeit meines Lebens war und ich als Prekariatstelephonverweigerer auch nicht am Gezwitschere teilnehme ;)
chrysophylax.de